EINJAEHRIGE AUSBILDUNG Fritten buden BELGIEN
Variationen über ein belgisches Nationalgericht
Von Doris Simon; Redakteurin am Mikrofon: Barbara Schmidt-Mattern
Mehr noch als Bier und Pralinen sind Pommes Frites eine typisch belgische Spezialität: Über alle Sprach- und Regionalgrenzen hinweg lieben Flamen und Wallonen, Deutschbelgier und Brüsseler ihre Fritten. Sie sind aus Kartoffeln geschnitten, nicht zu dünn und nicht zu lang, und werden in Rinderfett gebacken. Die belgischen Frites sind vielleicht das einzige gemeinsame Symbol des nationalen Stolzes in einem Land, das ansonsten ganz und gar uneitel ist.
An der Frittenbude ist die Welt für den Belgier noch in Ordnung. Dort lernt man seine Frau kennen, verdaut dort in der Mittagspause den Ärger mit dem Chef. oder isst zu Abend an der fritkot, weil der Kühlschrank zuhause wieder mal leer ist. Für den Belgier ist die Frittenbude Kneipe ums Eck, Schnellimbiss, und Straßenwohnzimmer. Außen cross und innen weich - so zieht die Fritte jeden an, den Anzugträger im Brüsseler Europaviertel genauso wie den Klempner in Antwerpen. Flamen, Wallonen, Brüsseler - , wenn es um die Fritte geht, sind sie plötzlich alle nur eins, nämlich Belgier.
Eine der besten Frittenbuden steht an der Place St. Josse, in einem der ärmeren Viertel von Brüssel. Seit 45 Jahren steht hier Martin Apers hinterm Tresen. Die kleine Portion gibt es bei ihm für 1,75, die große für 2 Euro 25; Saucen kosten extra. Die belgische Stiftung Warentest hat Martin Apers' Friture letztes Jahr zur besten von Brüssel gewählt. Martins Kunden wussten das auch so schon:
"Man sollte kein maulfauler Eigenbrötler sein": Einkehren bei Brüssels beliebtestem Frittenbäcker
Aaah, sie ist außen knusprig und innen zart, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ja, ganz ehrlich: von außen sieht diese Frittenbude nach nicht viel aus, aber der Geschmack der Pommes Frites hier, der ist wirklich gut.
Es ist noch nicht mal 12 Uhr mittags, aber über den Platz vor der Kirche im Brüsseler Viertel St. Josse wabert bereits der Duft von Pommes Frites. Stephane, ein zierlicher Mann, Hose und Hemd in gedeckten Beige, Brille mit Metallgestell, hat schon vor der Frittenbude gewartet, bevor Martin Apers überhaupt die Blechtüren aufgeklappt hatte.
Inzwischen steht Stephane nicht mehr allein vor der Frittenbude. Als Friturist Martin die frisch vorgebackenen Fritten zum zweiten Mal ins heiße Fett schüttet, hat sich bereits eine Schlange vor dem Ausgabefenster gebildet. Es ist heiß, 30 Grad sollen es mittags werden, aber das scheint die Stammkunden nicht abzuhalten. Es dauert hier immer ein bisschen, sagt Stephane, und er lächelt glücklich, denn gleich ist er dran. Seit ein paar Monaten kommt er jeden Tag:
Ich hatte schon gehört, dass das der Drei-Sterne-Frittentempel der Stadt ist. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, hier mal zu essen, bis das Unternehmen, in dem ich arbeite, ganz in die Nähe gezogen ist. Jetzt esse ich dauernd hier, ja, wirklich gerne.
Drinnen in der Frittenbude ist es ein gutes Stück wärmer als draußen. Daran ändert auch die Kühlung nichts, die über den zwei Fritteusen röhrt. Martin Apers, der mit seinen blonden Haaren, den Jeans und dem weißem T-Shirt deutlich jünger aussieht als 63, ist mitten drin im Frittenbacken: Nach dem pochage, dem Vorbacken, holt er die Fritten mit einer großen Kelle raus aus der linken Fritteuse, wirft sie auf die Stahlblechablage, und kippt sie dann in die rechte Fritteuse. Die fertigen Pommes Frites kommen in eine Blechschüssel, werden einmal kräftig gemischt. Mit zwei Handgriffen rollt Martin Apers aus grauem Papier eine Tüte, füllt Fritten ein, wickelt noch ein paar Lagen Papier herum. Dann hält er die Tüte unter den blechernen Salzstreuer, der an der Wand hängt, klopft zweimal gegen das Blech. Das Salz rieselt, Martin redet mit Stéphane.
Das Reden ist wichtig, sagt Martin, während er aus einem hohen Glas selbstgemachte Mayonnaise in eine kleine Plastikschachtel füllt. Reden ist mindestens so wichtig wie gutes Essen.
Ja, unbedingt, man sollte kein maulfauler Eigenbrötler sein. Man muss das schon mögen, mit den Leuten reden, ihnen zuzuhören. Viele Leute, die hierher kommen, die haben Probleme. Die wollen hier essen, aber auch von ihren Problemen erzählen. Sie hoffen, dass ich ihnen vielleicht einen guten Rat geben kann. Das sind Eltern, die Probleme mit ihren Kindern haben oder Kinder, die Krach mit den Eltern haben. Und weil sie seit eh und je zu mir kommen, da erzählen sie es mir halt eher als anderen.
Seit 45 Jahren steht Martin Apers sechs Tage die Woche in St. Josse und backt Fritten. So wie vor ihm sein Onkel und sein Vater. Vor ein paar Jahren ist er offiziell in Rente gegangen, aber er will nicht aufhören, es macht einfach Spaß, sagt er.
Viele Leute denken zuerst ans Geld, dass man mit einer Frittenbude richtig viel Geld verdienen kann. Das stimmt nicht. Man verdient schon, aber nicht schnell. Und viel arbeiten muss man auch. Wer seinen Beruf liebt, da läuft auch das Geschäft. Nur so geht's.
Und so arbeitet Martin noch ein bisschen weiter, so, wie er immer gearbeitet hat. Seine Fritten schneidet er selber, mit dem 13er Traditionsmesser: das ist die belgische Größe, schön dick, nicht so dünne Stengelchen wie die Tiefkühlfrites oder das, was es im Restaurant auf dem Teller gibt. An einem durchschnittlichen Tag wirft er 70 Kilo Bintje-Kartoffeln in die Friteuse, immer nur in frischem Rinderfett, das er jeden Tag wechselt. Auch wenn sein Lieferant meint, das Fett täte es doch noch ein paar Tage.
Rinderfett verstärkt den Geschmack der Kartoffel. Öle dagegen nehmen der Kartoffel den Geschmack. Öle dominieren zu sehr. Die Deutschen müssten das eigentlich wissen, wo sie die Kartoffeln doch ebenso schätzen wie wir Belgier.
Seine Fleischspieße und Fricandelles bereitet ein Metzger täglich frisch nach Martins Rezept. Die Saucen macht Martin selber, die Feinheiten hat er sich als junger Mann bei einem gelernten Saucier abgeschaut. Martins Kühlschrank hat kein Tiefkühlfach, von den Produkten der großen Marken, die es in fast allen anderen Frittenbuden gibt, hält der 63jährige nichts.
Die Ardenner Spießchen, die die zwei Bauarbeiter wollen, die gibt's bei Martin nicht. Er erklärt es ihnen, und bietet ihnen statt dessen seine hausgemachten Fricandelles an. Die Arbeiter sind zufrieden. Die Schlange vor der Martins Bude wird immer länger: Anzugträger, Studenten, zwei alte Frauen und ein alter Mann, ein Polizist.
Meine Kundschaft ist bunt zusammengewürfelt. Ein paar belgische Senatoren essen hier regelmäßig, und Botschafter kommen auch vorbei. Wobei die öfter den Chauffeur schicken, der muss die Portion dann holen. Ja klar, warum nicht? Die mögen doch auch Fritten!
Jetzt sind Jeannine und Francis dran, langjährige Stammkunden von Martin. Sie ist eine kräftige Frau Mitte achtzig in einem geblümten Sommerkleid, die große Handtasche fest unter den Arm geklemmt. Ihr Mann Francis hat ein weiches Gesicht und ist etwas jünger. Spätestens bei der Bestellung der Saucen wird klar, wer in dieser Ehe das Sagen hat:
Zwei Saucen! - Eine, das reicht doch. - Nein, zwei, sonst nimmst du dir wieder von meiner. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen!
Jeannine und Francis kommen schon seit 35 Jahren an die Frittenbude von Martin Apers. Jeannine, selber Tochter von Kartoffelbauern, schwört auf seine Fritten:
Ich sage Ihnen, solche einfachen Frittenbuden machen die besten Fritten. Selbst wenn Sie zuhause Pommes Frites backen, das schmeckt nie so gut wie hier. Die benutzen besondere Fette, aber ich darf das nicht weitersagen, das ist ein Geheimnis.
Martin Apers lächelt, als das alte Ehepaar laut diskutierend mit seinem grauen Päckchen abzieht. Zwei Portionen Fritten und zwei Saucen, so, wie Jeannine es wollte.
Fastfoodketten sind die natürlichen Feinde der belgischen Frittenbude, obwohl die eine viel längere Tradition hat. Im 19. Jahrhundert entstanden, waren die fritkots zuerst auf Jahrmärkten zu finden. International machten die Fritten später Karriere als "French Fries" - also französische Pommes. Diese Bezeichnung ist vermutlich während des Ersten Weltkriegs entstanden, als Soldaten aus Übersee in West-Flandern landeten, und dort auf eine belgische Armee trafen, die damals ausschließlich französisch sprach. Also erklärten die Amerikaner die Pommes kurzerhand zur französischen Fritte. Ihr eigentlicher Siegeszug begann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute ist der Belgier beim Thema Fritten konservativ. Als Behältnis am besten eine Papiertüte, als Esshilfe am besten Holzgäbelchen, und im übrigen sollte keine Fritte dicker als zehn Millimeter sein. Neumodisch gesägte oder gar dreieckige Fritten haben sich am Markt jedenfalls nicht durchsetzen können.
Weil die Fritte nun einmal ihre eigene Kulturgeschichte hat, interessiert sich Paul Ilegems für sie. Eigentlich ist Ilegems Dozent für zeitgenössische Kunst an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen - vor allem aber ist er seit bald einem Vierteljahrhundert Belgiens "Frittenpapst".
Die Frittenbude als Einheit stiftendes Nationalsymbol: Besuch bei Paul Ilegems, Kunstdozent und Belgiens "Frittenpapst"
12 mittags, Hochbetrieb in Antwerpens beliebter Frittenbude Frietkot Max, die im Erdgeschoss eines dreihundert Jahre alten Hauses am Groeiplaats untergebracht ist.
Anfangs fanden das viele total verrückt. Ich war eigentlich ein wandelnder Belgierwitz, weil ich mich für Fritten interessierte. Jeder fand das lächerlich.
Es war 1981, da wurde die Sache mit den Pommes Frites auffällig. Paul Ilegems war gerade Dozent an der Kunsthochschule geworden, Fachgebiet Zeitgenössische Kunst, die Freunde gratulierten, schöne Aufgabe. Aber ihn trieb ganz anderes um: Er hatte gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Es war ein Gedichtband, und der Titel lautete: "Frieten bakken". Es sollte nicht sein letztes Buch zum Thema bleiben, denn noch im selben Jahr rief Paul Ilegems eine Sammlung ins Leben, die den Ruf des Kunstprofessors als Belgiens Frittenpapst begründete: Das Frietkotmuseum oder: Frittenbudenmuseum.
Aber als ich mit dem Sammeln anfing und eine Ausstellung aufbaute, die in mehreren Städten gezeigt wurde und die sehr erfolgreich war, da brachte man mir doch etwas mehr Respekt entgegen. Dann habe ich mit dem Bücherschreiben begonnen, vier habe ich inzwischen über die Frittenkultur veröffentlicht. Ich finde, es sind ganz unterhaltsame Bücher geworden, auch weil viele schöne Fotos von Frittenbuden aus meinem Archiv darin abgebildet sind....
Paul Ilegems schaut in die Sonne und streckt seine langen Beine unter dem grünen Plastiktischchen aus. Neben und vor dem großen, schlanken Mann mit den grauen Haaren sitzen Leute jeden Alters und essen Pommes Frites, Frikadellen und Würstchen. Hinter ihm stehen ein gutes Dutzend Männer und Frauen an der Theke, die auch etwas zu essen wollen. Frietkot Max ist eine traditionsreiche Frittenbude direkt am Antwerpener Groeiplatz, und, dem Andrang nach zu urteilen, eine ziemliche Goldgrube. Paul Ilegems nickt:
Frittenbuden sind eine kleine Maßeinheit in der belgischen Wirtschaft, sehr klein, man muss nicht groß investieren, um eine Frittenbude aufzumachen. Mit einem bescheidenen Budget kann man hier selbstständiger Unternehmer werden und vielleicht auch sehr viel Geld verdienen - wenn man sich anstrengt, gute Fritten macht und einen guten Standort hat, dann kann so eine Bude sehr rentabel werden, unbedingt. Da wird gutes Geld verdient.
Im Stockwerk über den Friteusen und der Mikrowelle ist Paul Ilegems ganzer Stolz untergekommen: Sein Frittenbudenmuseum. Vier mal vier Meter hat der Raum: Dort kann jeder an einem Tischchen seine mitgebrachten Frites essen und dabei die jüngste Ausstellung an den Wänden bewundern. Derzeit hängen dort Hüllen von Platten und CDs, die sich alle mit Pommes Frites beschäftigen: französische Chansons über das seltsame Nachbarland Belgien, wo es die Fritten gibt, oder vollbusige niederländische Schlagersängerinnen, die laut Plattenhülle jeden Tag Friet met Mayonnaise essen, bis hin zu gesungenen Belgierwitzen auf LP.
Tja, es ist eine kuriose Sammlung von Plattenhüllen, auf denen Pommes Frites thematisiert werden. Deshalb heißt die Ausstellung auch "Die singende Fritte".
Weil das Museum so klein ist, liegen die meisten Bestände in Kisten zuhause bei Ilegems oder sind unterwegs in Wanderausstellungen. Im Ausland sind seine Frittenausstellungen fast so beliebt wie das Produkt selber, erzählt Paul Ilegems stolz:
Belgien gilt als DAS Frittenland, dort, so heißt es, sind die Fritten am leckersten. Es ist auch das Land, wo man am meisten Frittenbuden findet: In den Dörfern, entlang der Straßen, oft sieht man an völlig unerwarteter Stelle plötzlich eine Frittenbude. Das ist typisch belgisch, diese Verbreitung der Frittenbuden entlang der Straßen bis ins kleinste Dorf. Und das ist seit langem so, denn Belgien hat eine lange Frittenbudenkultur: Die ersten entstanden bereits um 1830, da war das Königreich Belgien gerade gegründet worden. Die Frittenbude ist also genauso alt wie Belgien.
Belgien als das erste Land der Welt, das gleich mit einer Frittenbude zur Welt kam - das könnte von Paul Ilegems stammen. Wenn er anfängt, über sein Lieblingsthema zu sprechen, dann hört er so schnell nicht mehr auf. Links und rechts von ihm essen die Leute im raschen Wechsel und gehen, die Tische sind rasend begehrt. Paul Ilegems ist die Ruhe selbst, er hängt sein Jacket über die Stuhllehne und erzählt weiter. Er ist übrigens der einzige, der keine Pommes Frites isst. Vielleicht später, sagt er. Jetzt geht es ihm um die nationale Dimension der belgischen Frittenbude:
Die Frittenbude ist ein Symbol der Einheit unseres Landes, ein Symbol Belgiens- das einzige Symbol der Einheit Belgiens. Denn unser Land ist ja ein zersplittertes Land, ein föderaler Staat mit der Flämischen und der französischen Gemeinschaft und Brüssel, das ein eigenes Statut hat. Das Einzige, das Flamen, Wallonen und auch deutschsprachige Belgier wirklich verbindet, das ist die Frittenbude.
Sechs Bücher hat Paul Ilegems den belgischen Fritten gewidmet und ihrer einzig wahren Heimat, der Frittenbude. Er hat als Erster belgische Frittenbuden als Kunstobjekte untersucht, und sie nach ihrer Architektur geordnet:
Früher war die Frittenbude viel improvisierter, anarchistischer. Es gab keine Vorschriften, jeder tat, wozu er Lust hatte, echt belgisch, wirklich hundertprozentig belgisch. In der Folge wurden Fritten gebacken in alten Bussen, die mit ein paar Handgriffen umgebaut wurden, oder in alten Campingwagen, manchmal baute sich der Besitzer seine Bude auch selber, aus irgendwelchem billigen Material , das waren dann die Baracken: Nicht fest, nicht stabil und nicht wirklich hygienisch- das alles gabs eben früher. Diese anarchistische Atmosphäre findet man immer seltener, die Frittenbude ist sozusagen luxuriöser geworden.
Der Belgier liebt nur Regeln, die er bei Bedarf neu erfinden kann - hat ein Zeitungsreporter einmal festgehalten. So gelten früher oft ohne Baugenehmigung aufgestellte Frittenbuden zwar einerseits noch immer als Hort der Anarchie - beim Frittenbacken selbst gibt es indes ein strenges Reglement. Fritte ist nicht gleich Fritte. Das geht los mit der Kartoffelsorte - besonders gut eignen sich zum Beispiel "Desirée" oder "Bintje". Wichtig außerdem: Die belgische Fritte wird nicht ein-, sondern zweimal gebacken. Das verhindert das Austrocknen von innen, und das Anbrennen von außen. Beim ersten Fritiervorgang bleiben die Streifen so lange im Fett, bis sie anfangen zu "singen", das heißt, an der Oberfläche zu brodeln.
Über 5000 Frittenbuden gibt es in dem kleinen Land Belgien, stellte man sie alle nebeneinander, würden sie 3052 Fußballfelder bedecken. Außen gerne fettbesprenkelt, innen eher karg, ist in den Frittenbuden gerade mal genug Platz, um sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, nämlich gute Fritten zu backen. Alle Vorarbeit übernehmen Leute wie Vincent Despriet. Sein Betrieb steht in Seraing, einer kleinen Nachbarstadt von Lüttich. Im Hauptbetrieb mit zwei weiteren Niederlassungen und 35 Angestellten macht Despriet aus Bintjes-Kartoffeln rohe Pommes Frites, sechs Tage in der Woche, und jeder Tag beginnt für seine Leute schon zu nachtschlafender Zeit:
Alles rund um die Fritte: Im Kartoffelschälbetrieb von Vincent Despriet
Drei Uhr nachts in Seraing. Hinter einer meterhohen Mauer breitet sich ein endloses Gewirr von Türmen, Leitungen und Hallen aus. Das ist Cockerill, ein Dinosaurier, das heruntergekommene Stahlwerk von Seraing. Genau gegenüber liegt die schlichte Halle mit der Kartoffelverarbeitung von Vincent Despriet. Sie wirkt vor der Kulisse des sterbenden Stahlgiganten beinah unanständig frisch und modern. Nur der Lärm ist hier fast so laut wie gegenüber.
Die Kartoffelschälmaschine dröhnt bis in die hinterste Ecke der langgestreckten Fabrikhalle. Aber Angelo trägt keine Ohrschützer. Der untersetzte 44jährige mit dem kräftigen Bäuchlein unterm Hemd winkt auf Nachfrage nur ab. Angelo ist Fahrer. Er bereitet gerade die Lieferung für eine Frittenbude in Lüttich vor: Er wickelt von unten nach oben große Bahnen Plastikfolie um eine Palette, auf der Pommes Frites in zehn Kilo-Säcken liegen- frisch geschält und geschnitten vom Krachmacher neben ihm und dann automatisch vakuumverpackt. Auf einer anderen Palette stellt Angelo Eimer und Flaschen mit Fritierfett zusammen, Plastiktöpfe- und Kanister mit Pommes-Frites-Saucen, Aufbackbrötchen und Getränke.
Jetzt warte ich darauf, dass die Magazin-Arbeiter das Tiefkühlabteil meines Lasters auffüllen, dann belade ich den Rest.
Angelo stammt wie viele Belgier in der Lütticher Gegend aus einer italienischstämmigen Familie. Doch mit Fritten kennt er sich besser aus als mit Nudeln:
Ich hab' als Junge angefangen in der Frittenbude meines späteren Schwiegervaters, ohne Vorkenntnisse, da habe ich jahrelang gearbeitet. Also richtig von der Pike auf gelernt, nicht nur auf dem Papier!
Im Frittengewerbe hat sich in den letzten vierzig Jahren einiges verändert, erzählt Firmenchef Vincent Despriet. Er ist ein großer, jungenhafter Mann in Jeans und Turnschuhen. Während er die Schneidemaschine für die Pommes Frites kontrolliert, reibt er sich immer wieder die leicht geröteten Augen. Wie seine Arbeiter ist auch Despriet jeden Morgen um drei Uhr im Betrieb:
Als mein Vater vor vierzig Jahren hier anfing, da schälten wir keine Kartoffeln. Wir kauften damals Kartoffeln beim Bauern und verkauften sie dann in 3 oder 5 Kilo-Säcken an die Frittenbudenbesitzer weiter. Das mit dem Schälen der Kartoffeln ging erst Ende der Siebziger langsam los, damals schnitt noch jeder seine Kartoffeln selber. Heutzutage macht eigentlich kein Frittenbudenbesitzer seine Pommes Frites noch selber aus Kartoffeln, alle kaufen frittierfertige Fritten. Eine ganz andere Mentalität!
Darauf hat sich Vincent Despriet eingestellt. Als er den Betrieb von seinen Eltern übernahm, hat er sich erst mal verschuldet und kräftig in moderne Maschinen investiert: Unter anderem in die vollautomatische Anlage, die Kartoffeln schält, wäscht, in Pommes Frites schneidet und sie anschließend vakuumverpackt.
Es liegt aber nicht nur an den Investitionen, dass aus dem braven Kartoffelan- und verkauf der Eltern Despriet inzwischen ein Grossist in Sachen Pommes Frites geworden ist, der sich erfolgreich zwischen den großen Marktführern hält. Wir machen das, was unsere Kunden wollen, so lautet Vincent Despriets Mantra.
Unser Ziel ist es, alles rund um die Fritte zu bieten. Jede Frittenbude muss mit jeglicher Ware, die sie braucht, von uns beliefert werden können. Das ist unser Geschäftsprinzip, und danach richtet sich unser Lager, alles von A bis Z muss lieferbar sein. Wir haben selbst Heftpflaster und Alleskleber, falls jemand das will. Wir müssen unseren Kunden alles bieten können. .
Dementsprechend groß ist das Sortiment im Magazin und im Tiefkühlraum: Hier lagern Tausende von Fleischsnacks, Regale mit Dutzenden verschiedener Sorten Fritierfett, 150 bis 200 Sorten Saucen - das weiß der Chef selber nicht genau- und ein ganzer Gang voller Getränke, von der Sojamilch bis zum Wein. Kartons mit Servietten reihen sich an Plastikverpackungen mit Bechern, Pappgeschirr und Kaffeeplätzchen - alles doppelt und dreifach, von verschiedenen Herstellern. Der Kunde will es so.
In einer Ecke liegen ein paar braune Plastikbeutel: Tiefkühlfrites, aus Kartoffelmehl gepresst. Wie kommen die in einen Betrieb, der von frischen Kartoffel-Fritten lebt? Fahrer Angelo verdreht die Augen:
Das ist niederländische Ware, Tiefkühlfritten, vorgebacken- einfach ungenießbar. Am liebsten würde ich die wegwerfen, aber es gibt einen Kunden, der will die, da ist nichts zu machen, da müssen wir liefern.
Es zählt, was der Kunde will. Deshalb können Frittenbudenbesitzer bis morgens um zwei ihre Bestellung für den Tag abgeben. Ehefrau und Schwester des Chefs tippen die Bestellungen und geben sie dann an die Fahrer weiter.
Inzwischen sind auch die Arbeiter mit den Bestellungen aus dem Tiefkühlabteil in die Halle gekommen. Mit dem Gabelstapler fahren sie die Paletten zum Laster: Für jede Frittenbude eine eigene Palette, damit es beim Ausladen schneller geht.
Es ist vier Uhr morgens geworden. Fahrer Angelo wird sich gleich in die Fahrerkabine seines weißen Lasters schwingen. Die nächsten sechs Stunden ist er dann von Frittenbude zu Frittenbude unterwegs. Ein ziemlich einsamer Job:
Die Besitzer sind um diese Zeit nicht da. Also schließe ich auf und räume die Ware ein, die Tiefkühlsachen gleich in die Kühltruhe, die empfindlichen Produkte in den Kühlschrank und den Rest in die Regale. Wenn der Besitzer um 10 Uhr morgens kommt, ist er zufrieden, denn seine Bestellung ist eingeräumt und er kann loslegen. Wenn ich jetzt fahre, dann habe ich sicher 30 Schlüssel dabei.
Ja, ich weiß schon, dass das ein Vermögen wert ist. Aber so ist das halt. Wir wollen früh anfangen, damit wir früh fertig sind und niemanden bei der Arbeit stören. Da gibt's auch keine Probleme mit dem Verkehr, aber dafür brauchen wir die Schlüssel. Das erklären wir in aller Ruhe unseren Kunden, und die geben uns dann auch die Schlüssel. So ist jeder zufrieden und es ist für alle besser so!
16 Jahre arbeitet Angelo schon für die Despriets, und die Arbeit macht ihm immer noch Spaß. Dass er früh aufstehen muss, stört ihn nicht, im Gegenteil. So kann er tagsüber miterleben, wie seine Kinder groß werden. Wenn sein Rücken mitmacht, dann möchte Angelo bis zur Rente weiter Fritten ausfahren. Und dabei nach jeder Tour irgendwo schnell noch eine Portion mit Sauce Andalouse und Frikadelle essen. Gute Adressen kennt er ja genug:
Auf unsere Fritten sind wir Belgier stolz. Hier gibt es wirklich gute Fritten. Ob man nach Frankreich kommt oder anderswohin, wenn von Fritten die Rede ist, dann meinen sie: belgische Fritten.
Unsere Stadt soll schöner werden - dieser Ehrgeiz hat auch belgische Städteplaner erfasst. So genanntes City-Marketing soll mehr Besucher in die Städte locken, und vertreibt doch die eigenen Bürger. Denn die kommen wegen der Fritten. Nun gilt aber die klassische Frittenbude nicht unbedingt als ästhetisch, und so herrscht seit einiger Zeit Alarmstimmung hinter manchen Friteusen. Was nicht schön ist, soll weg, weshalb viele Frittenbuden dran glauben mussten in den letzten Jahren. Entweder zu hässlich, zu unhygienisch, oder zu verkehrsbehindernd - die Ordnungshüter haben der Anarchie des belgischen Frittenwesens den Kampf angesagt: Von einem Feldzug gegen die Frittenbuden ist schon die Rede. Dabei ist gerade das individuell und manchmal schief in die Gegend gebaute Büdchen oder Haus irgendwie ein Teil belgischen Kulturguts. Anders gesagt: An der Frittenbude fühlt der Belgier sich zu Hause.


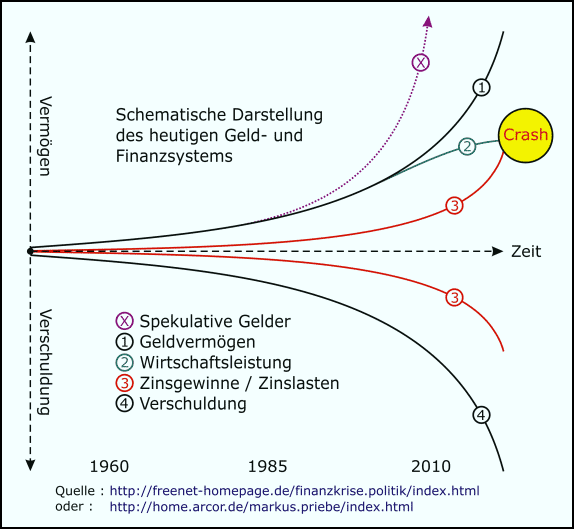
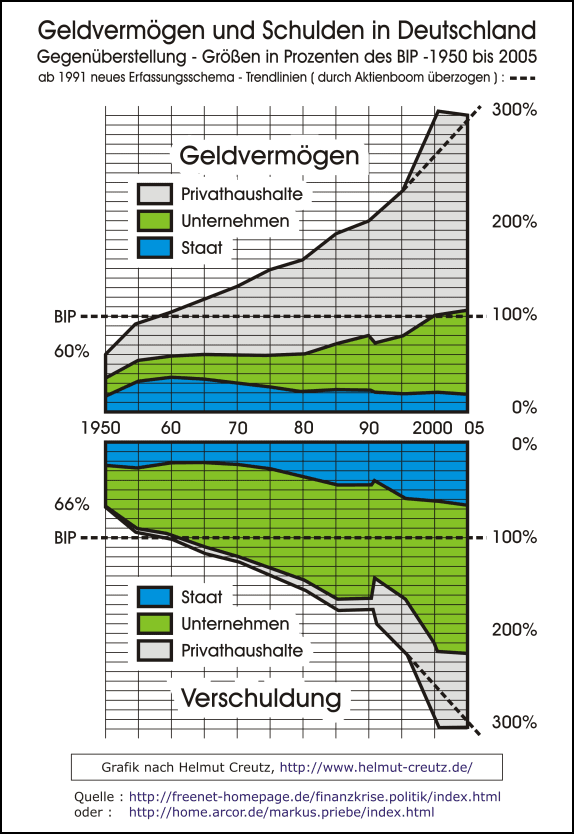
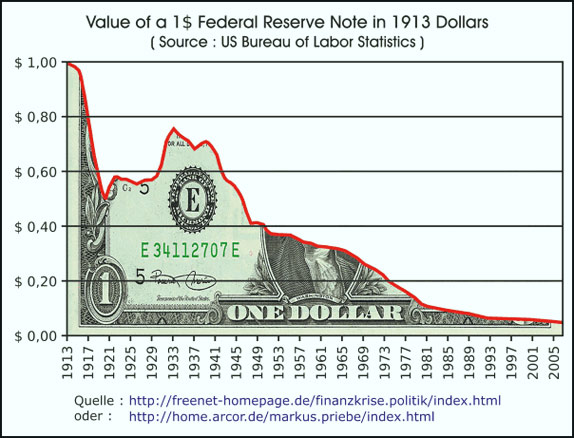


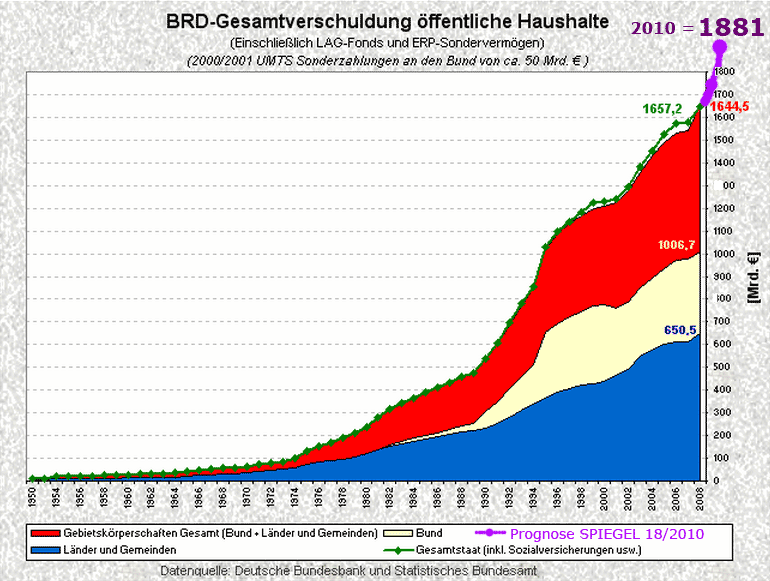


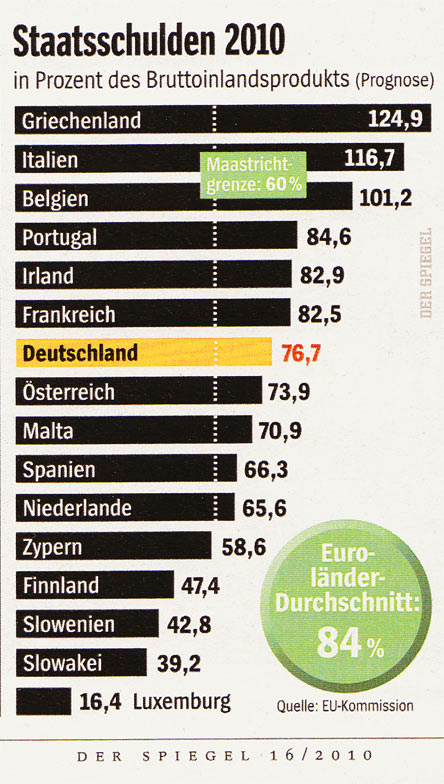
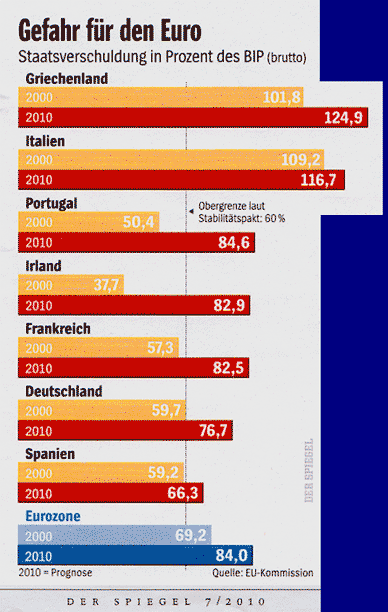
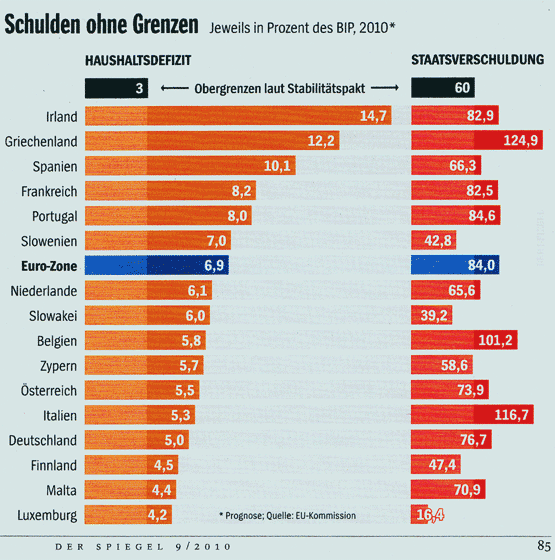
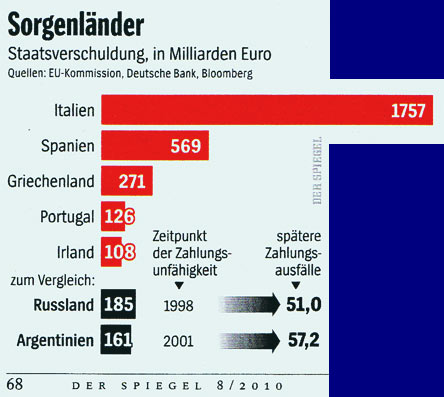
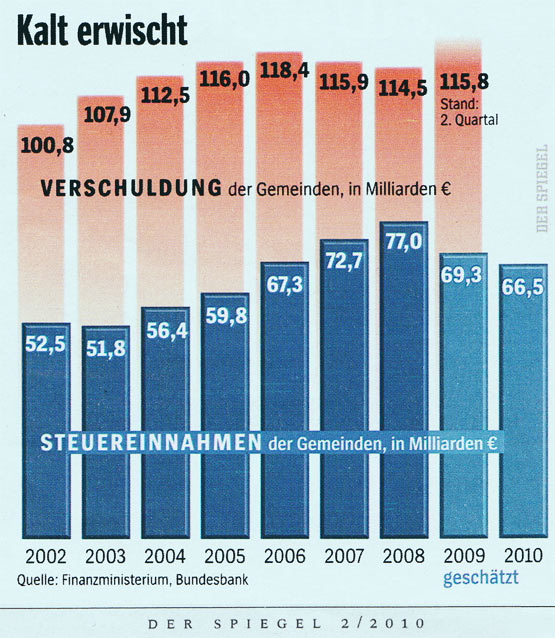

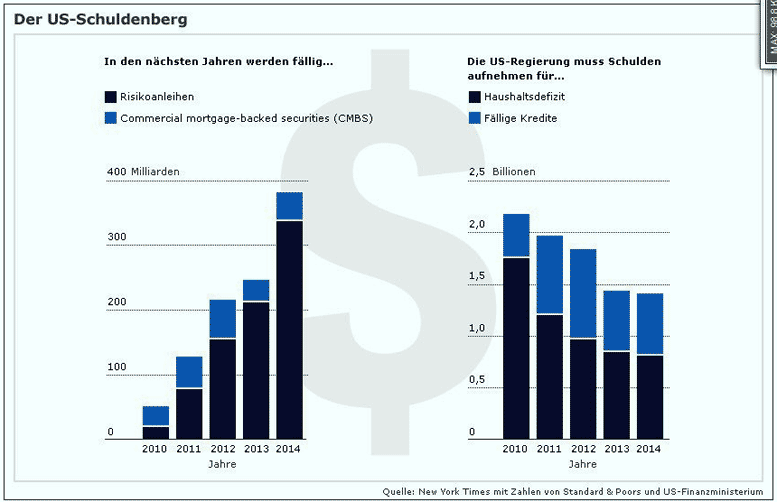

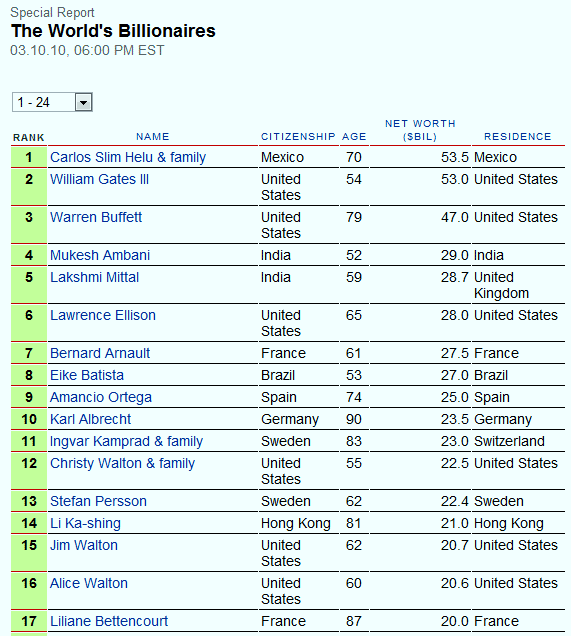
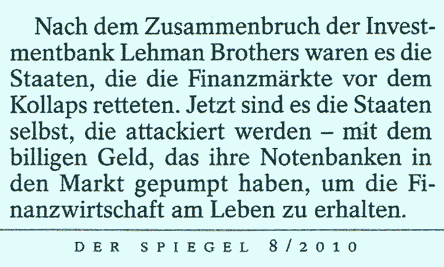
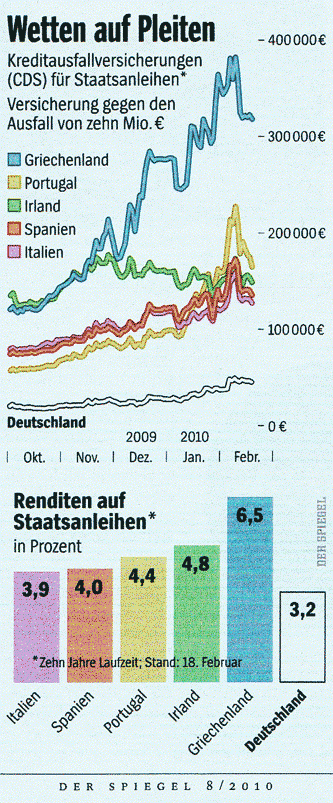
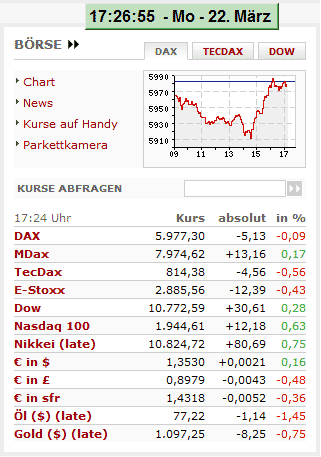
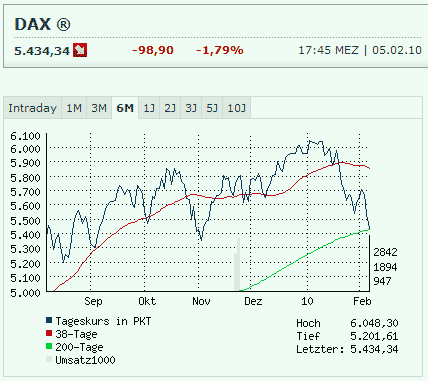
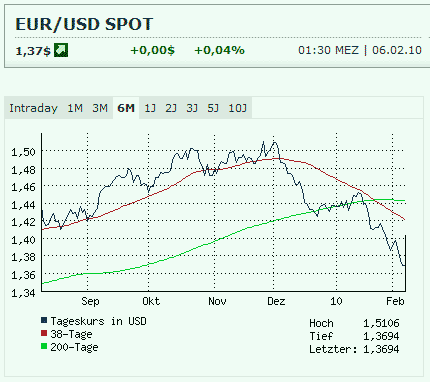
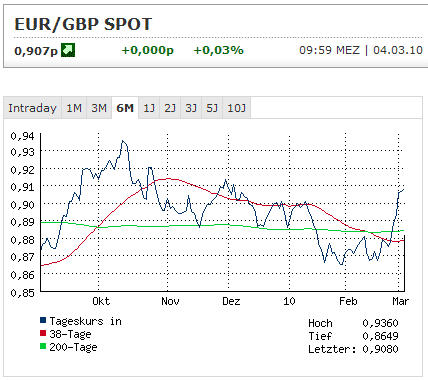
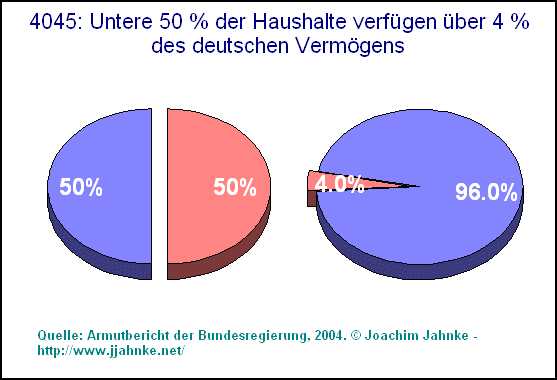
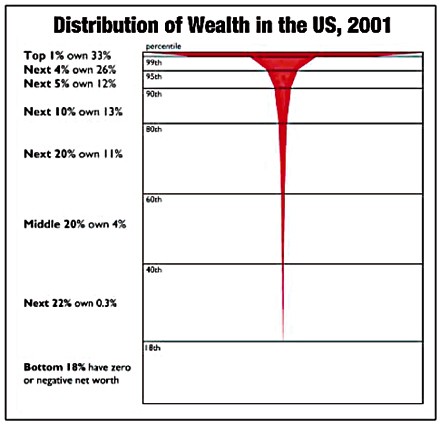
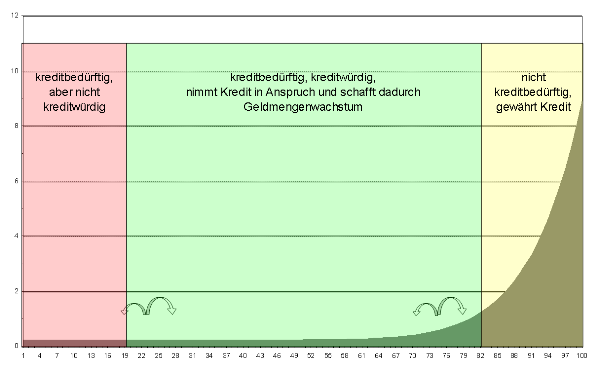
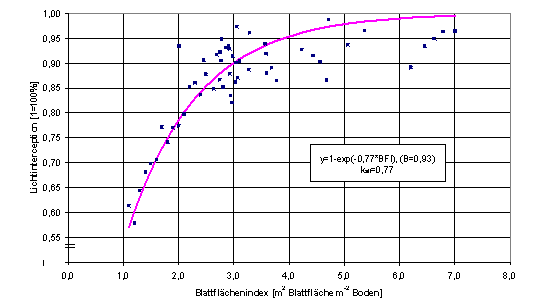
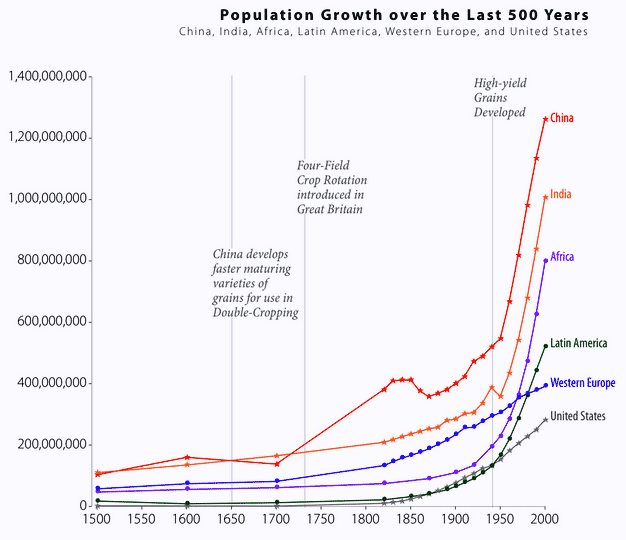
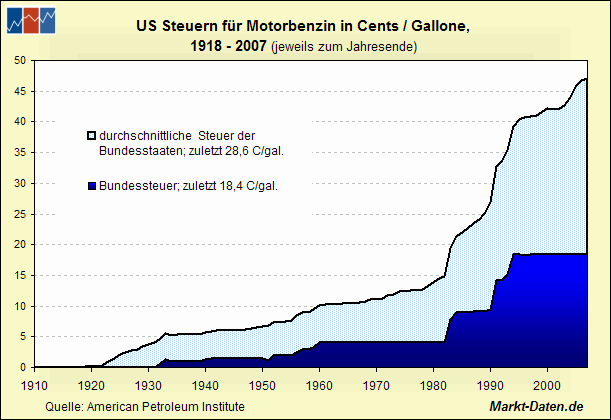
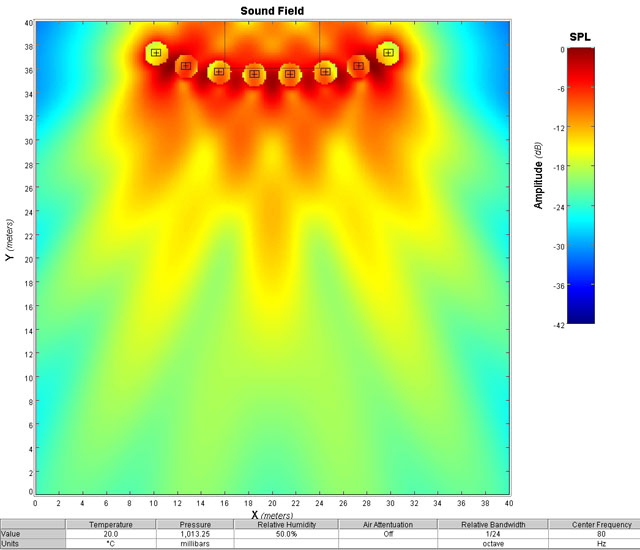
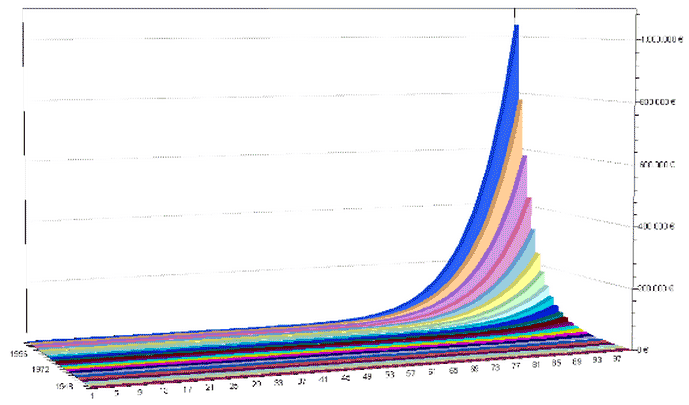

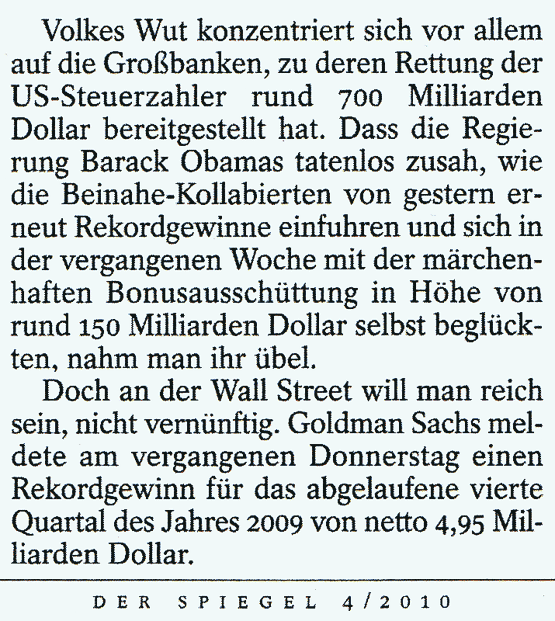
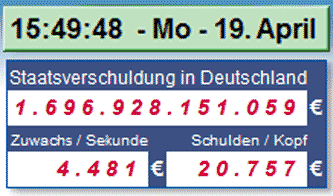
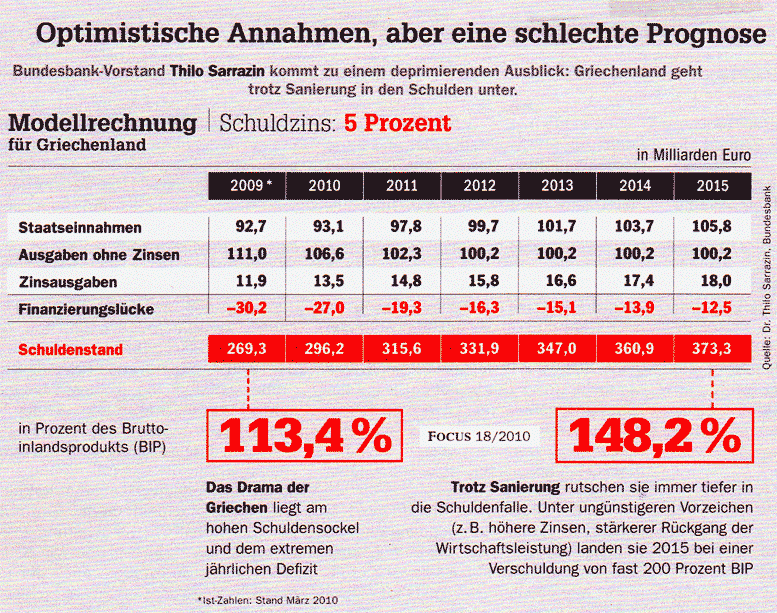
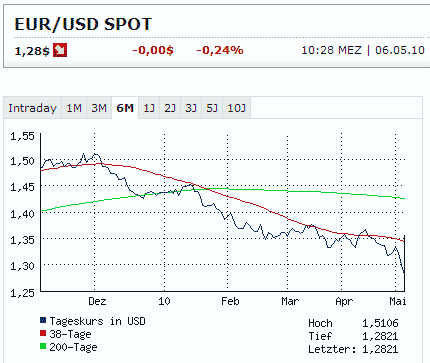



 Erdmagnetfeld:
Erdmagnetfeld:
