von Heiner Flassbeck
Wenn ich in den vergangenen Jahren an den unterschiedlichsten Plätzen in der Welt über Island gesprochen habe, wurde ich immer angeschaut, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Island, sagten die Zuhörer, warum redet der über Island, ein Miniland im Nordmeer, das niemanden interessiert. In diesen Wochen sind die deutschen Zeitungen voll von Geschichten über Island, weil da offenbar ein ganzes Land von den Finanzmärkten in den Ruin getrieben wird.
Warum hat niemand sonst darauf geachtet, warum hat kein Finanzminister dieser Welt Alarm geschlagen, warum hat kein Forschungsinstitut vorher erklärt, dass das nicht gutgehen kann? Die Antwort ist einfach: Weil die Meisten schon gar nicht mehr hinschauen und wenn sie hinschauen, schauen sie gleich wieder weg, weil es ja so peinlich wäre, wenn man sagen müsste, da macht ein Markt vollkommenen Blödsinn, da läuft etwas fundamental schief, obwohl es der globale Finanzmarkt mit all seinen smarten Bankern ist, der da das Ruder in der Hand hat.
Ein anderes Beispiel: In Deutschland hatten wir mal so etwas wie einen Generationenvertrag. Die Gesellschaft insgesamt sollte dafür sorgen, dass mit Hilfe einer wachsenden Wirtschaft und steigender Einkommen eine angemessene Rente für die Alten im Land gezahlt wird. Das aber war plötzlich altmodisch. Wir wollten individuell werden und ansparen, unser Geld also selbst mit Hilfe der Finanzmärkte in die Zukunft transportieren und nicht auf ein staatliches Versprechen für die Zukunft setzen.
Wenn jeder sein Geld am Aktienmarkt investiert, so die wunderbare Idee, erzielt man höhere Erträge und man hat wirklich etwas in der Hand. Dass man aber Geld gar nicht in die Zukunft transportieren kann, hat niemand gesagt. Dass das Geld immer da bleibt, dass wir es nur anderen Leuten in die Hand geben, die damit ihr Glück versuchen oder sich im Glückspielen versuchen, wollten wir nicht wahrhaben. Man hätte ja sagen müssen, die Banken sind auch nicht besser als der Staat, die können auch nur etwas versprechen und wenn sie ihr Versprechen nicht halten, gibt es keine Rente. Wer hätte so was schon sagen wollen in den modernen Zeiten der Individualität? Jetzt aber muss wieder der Staat einspringen, weil die Spieler in den Banken das schöne Geld verzockt haben. Das ist die Logik der modernen Finanzwelt: Zuerst verdammt man den Staat, und am Ende bettelt man, dass der Staat die Zeche zahlt.
Und tatsächlich: Jetzt, wo alles zusammenzubrechen droht, greift, vor allem in den Vereinigten Staaten, der Staat hart und konsequent durch. Man hat erkannt, dass der Markt sich nicht selber heilen kann. Das System ist instabil. Nur .Vater Staat. kann die Finanzkrise unter Kontrolle bekommen.
Der Glauben an den Markt
Dabei waren gerade die USA, was den Glauben an die Finanzmärkte betrifft, immer hochgradig dogmatisch. Erst im Angesicht der Krise handeln sie nun so pragmatisch, wie es schon lange vorher erforderlich gewesen wäre. Vor der Krise dagegen glaubte man bedingungslos an die Kraft der Märkte. Frei nach dem Motto: Die kriegen das von allein hin, die funktionieren und regulieren sich quasi von selbst. Das war aber auch in ihrem eigenen Denken ein systematischer Fehler: Der berühmte Liberale Friedrich August von Hayek hat die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Systems stets damit begründet, dass hier Millionen von Marktteilnehmern zusammentreffen, die alle über unterschiedliche und voneinander unabhängige Informationen verfügen, die der Markt dann in einen einheitlichen Preis für ein Gut verwandelt. Keine Regierung dieser Welt sei zu einer solchen Effizienz in der Lage.
Was aber weder in den Wirtschaftswissenschaften noch in der Politik verstanden wurde: Die Kapitalmärkte funktionieren anders als der Handel mit Kartoffeln und Maschinen . wie wir angesichts der gegenwärtigen Finanzmarktkrise eindringlich erleben. Bei den .wirklich großen Spielen. um Zinsen, Wechselkurse, Aktien, Immobilienpreise und Rohstoffe kommt eine Handvoll privilegierter Akteure zusammen, die alle nicht mehr wissen, als der Staat weiß. Alle sind ferngesteuert von ein paar Informationen, die, für jeden zugänglich, permanent über die Bildschirme jagen und von allen Beteiligten in ähnlicher Weise gedeutet werden.
Wenn also bestimmte Ereignisse eintreten, wie beispielsweise eine Rohstoffpreishausse, oder sich irgendwo Zinsdifferenzen zwischen Staaten auftun, dann springen fast alle Spieler gleichzeitig auf diesen Zug und versuchen, sich eine goldene Nase zu verdienen. Das geht genau so lange gut, bis sie den Preis oder den Wechselkurs so weit weg von dem Wert getrieben haben, den die reale Welt, also die richtigen Menschen, zu verkraften in der Lage sind, bis es nicht mehr geht. Dann kollabiert das ganze Spielsystem, das meist nichts anderes ist als ein Kettenbriefsystem, bei dem jeder versucht, nicht der Letzte zu sein.
Dieses Spiel im großen Kasino namens Finanzmarkt wird dadurch noch absurder und natürlich riskanter, dass die gierigen Finanzmarktzocker und ihre Banker die eigenen Gewinne dadurch in die Höhe jubeln, dass man den Großteil der Spekulation mit Schulden finanziert. Man leiht sich also zu dem Geld, das man ohnehin schon in der Tasche hat, noch viel mehr Geld dazu und investiert es in Anlagen, die eine etwas höhere Rendite erbringen als der Zins, den man den anderen Banken oder den braven Anlegern zahlt. Das ist der große Hebel, mit dem Banken, Hedgefonds und sogenannte Private-Equity-Fonds die Rendite auf das Eigenkapital in ungeahnte Höhen treiben können, wenn sie nur genügend Kredit bekommen.
Das Schlimme ist, dass niemand gesehen hat, dass hier Spiele gespielt werden, bei denen immer der eine nur gewinnen kann, was ein anderer verliert. Wären alle Spekulanten mit dem geliehenen Geld lediglich ins Spielkasino gegangen, wäre der Spuk schnell zu Ende gewesen, genauer: Man hätte ihnen gar kein Geld geliehen. Die Methode, die Renditen mit Schulden zu heben, funktioniert für das gesamte globale Finanzsystem nur dann eine Weile, wenn alle Spieler bestimmte Objekte finden, bei denen sie sich mit einer gewissen Plausibilität einreden können, sie würden hohe Renditen bei geringem Risiko bieten, weil die Preise für immer steigen oder der Wechselkurs immer in eine Richtung geht, weil die Zinsdifferenzen für immer bestehen bleiben.
So ein Objekt war der amerikanische Häusermarkt in den letzten zehn Jahren, so ein Objekt war auch Island, weil es scheinbar risikolos hohe Zinsen und eine starke Währung bot. In den 20er Jahren übernahmen diese Rolle Aktien neu aufgekommener Konsumgüterhersteller und in den 90er Jahren Aktien der Telekommunikation. Auch Unternehmen mit hohem Eigenkapitalanteil zu kaufen, ist neuerdings beliebt, weil man die Rendite allein dadurch hochjubeln kann, dass man Eigenkapital durch Schulden ersetzt. Letzteres tun sogenannte Private-Equity-Firmen, also Unternehmen, die genau das Gegenteil dessen tun, was ihr Name sagt: Sie vermindern nämlich systematisch das Eigenkapital, statt solches zur Verfügung zu stellen.
Das ist primitiv und kann doch kurzfristig hoch profitabel sein. Unterstützer gibt es viele. Die .Wissenschaft. hat über Jahre die .hohe Effizienz der Kapitalmärkte. gelobt, 1 die Politik ist wie bei der Rente vor den .Werteschaffern. in den Banken und Versicherungen in die Knie gegangen und die Öffentlichkeit hat sich einreden lassen, wenn man nur spekuliert, bräuchte man eigentlich nicht mehr arbeiten, man würde mit dem schnellen Geschäft an den Finanzmärkten quasi ohne Risiko reich werden.
Schließlich haben die Medien diese Kampagne in einer Weise mitgemacht, dass man den Verdacht haben muss, dass einige Spindoktoren daran gut verdient haben. Wie man der deutschen Öffentlichkeit gegen jede Vernunft weisgemacht hat, ihre Rente könnte wegen der Alterung nur mit dem großen Spiel an den Finanzmärkten sicher gemacht werden, war wahrlich genial. Dass auch öffentlich-rechtliche Sender dazu übergegangen sind, jeden Abend mehrfach in den Nachrichten dümmliche Meldungen aus dem Kasino zu übertragen, spricht Bände.
Der Schein des .Produkts.
Was wir endlich begreifen müssen: Banken produzieren nichts. Die Volksverdummung hat schon damit begonnen, dass man das, was Banken ihren Kunden anbieten, als .Produkte. bezeichnet. Das klingt so, als seien Banken ebenso innovativ wie Produktionsunternehmen und würden alle paar Wochen ein .neues Produkt. auf den Markt werfen. Banken machen aber immer das Gleiche: Sie leihen Geld über relativ kurze Fristen und verleihen es über längere Fristen. Dabei ist Geld zu verdienen, weil die Zinsen für lange Fristen meist höher sind als die für die kurzen. Dabei geht man aber auch ein Risiko ein, weil die pünktliche Rückzahlung von Krediten an die Banken über lange Fristen nie so sicher ist wie die kurzfristige Verpflichtung der Banken gegenüber den Einlegern. Insgesamt ist es ein Geschäft . aber sicher kein Bombengeschäft, bei dem man systematisch und auf längere Zeit Renditen von 25 Prozent erzielen kann, wie es noch immer von der größten deutschen Bank propagiert wird.
Wenn ein Anleger in den letzten Jahren zur Bank ging, wurde ihm in der Tat weisgemacht, dass richtiges Arbeiten sinnlos ist. Sein Geld muss man arbeiten lassen und wenn man keines hat, muss man es halt leihen. So hat man den Menschen in den 90er Jahren argentinischen Dollarbonds mit 15 Prozent Zinsen mit dem Hinweis verkauft, das sei vollkommen sicher, weil es ja vom argentinischen Staat garantiert wird. So hat man in Ungarn und in anderen Ländern Osteuropas den Menschen eingeredet, man könne sich ruhig in Schweizer Franken verschulden (weil da der Zins niedriger war), auch wenn man selbst nur ungarische Forint verdient. Und wenn dabei auch der ungarische Forint noch steigt, umso besser, weil das die Hypothek verkleinert. Dass mit dem Steigen der eigenen Währung aber die eigenen Arbeitsplätze obsolet werden, hat niemand gesagt.
Das ist nun zu Ende, und das ist gut so. In großen Teilen der Finanzwelt war jedes Gefühl dafür verloren gegangen, dass das .Spiel. mit dem ersparten Geld von Menschen, die nicht verstehen, was auf den Finanzmärkten geschieht, nicht nur moralisch verwerflich ist, sondern auch wirtschaftlich in eine Krise führen muss, sobald die Wetten in großem Stil nicht aufgehen. Das aber ist immer dann der Fall, wenn irgendwo ein Schock ausgelöst wird, wenn sich die Konjunktur zu überhitzen droht und die Zinsen von den Notenbanken hochgezogen werden . oder wenn einfach offensichtlich wird, dass es nicht nur Gewinner geben kann.
Privatisierte Gewinne, sozialisierte Verluste
Was ist zu tun? Die raschen Interventionen der Zentralbanken waren zwar angebracht, weil sonst weit größere Schäden gedroht hätten. Aber das darf nicht heißen, dass der Staat, nachdem er wieder einmal Banken und andere Spekulanten vor dem Schlimmsten bewahrt hat, zur Tagesordnung übergeht. Damit provoziert er nur die nächste Krise, weil die Spieler im Kasino dann damit rechnen, dass es schon nicht so schlimm kommen wird. Wer, wie die Deutsche Bank, mit 25 Prozent Rendite protzt, dem muss man auch abverlangen, dass er 25 Prozent Verlust hinnimmt, ohne nach dem Staat zu schreien.
Hier liegt das Dilemma der leider notwendigen Rettung: Eigentlich müssen bei den Banken endlich auch Verluste auflaufen. Die Manager und Investoren müssen merken, dass es so nicht weitergeht. Strafe muss sein, wenn auch dosiert.
Andernfalls bekommen wir das eminent große Systemrisiko nicht in den Griff. Heute haben die Banker jedes Gefühl dafür verloren, was ein kalkulierbares Risiko ist und was nicht . mit denkbar extremen Folgen, ohne dass sie je das Risiko trifft. Josef Ackermann etwa forderte noch eine Woche vor dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers, dass hohe Renditen erzielt werden müssen, weil die Erwartungen der Investoren wieder steigen. Ackermann hat bis heute nicht begriffen, dass in einer funktionierenden Marktwirtschaft niemand, aber auch wirklich niemand einen Anspruch auf eine bestimmte Rendite hat. Ein Unternehmen hat sich anzustrengen, und dann wird man am Ende sehen, wie viel Rendite dabei rausspringt. Die unendliche Gier der Investoren schon im Voraus befriedigen zu wollen, stellt das marktwirtschaftliche System auf den Kopf.
Der Schwachsinn mit den .Ansprüchen des Kapitals. hat aber schon viel früher angefangen. Bereits zu Anfang der 80er Jahre sprach der deutsche Sachverständigenrat von Ansprüchen, die man befriedigen müsse, wenn man vernünftige Angebotspolitik macht. Mit dem Ende des Keynesianismus waren alle Dämme gebrochen, alles, was dem Kapital diente und die Arbeiter knechtete war gut. Das beste Beispiel für die Perversionen, die dieses Denken hervorgebracht hat, ist die Tatsache, dass deutsche Großunternehmen jahrelang nicht wussten, wie sie ihre riesigen Gewinne anlegen sollten und sich in vollkommen unrentable Abenteuer stürzten, wie etwa der Chryslerkauf von Daimler oder ähnliche Transaktionen, statt für ihre Arbeiter die Löhne ordentlich zu erhöhen, so dass diese sich ein Auto der eigenen Firma kaufen konnten.
Kontrolliert die Banken und Agenturen
Dennoch kann der Staat heute vor der Dramatik der Krise nicht die Augen verschließen, weil ansonsten eine erhebliche Ansteckungsgefahr für gesunde Institute droht. Aber grundsätzlich muss der Staat den Banken schon lange vorher auf die Finger klopfen: nämlich dann, wenn sie mit völlig unrealistischen Renditezielen in aller Öffentlichkeit protzen.
Zum anderen muss die Politik beginnen zu verstehen, dass die großen Spiele, die da rund um den Globus gespielt werden, für die reale Wirtschaft vollkommen nutzlos sind. Dass die Hypothek eines amerikanischen Häuslebauers noch 23 Mal auf den internationalen Finanzmärkten in der Form irgendwelcher .Produkte. verscherbelt wurde, war ja sogar schädlich für das amerikanische Häuserbauen. Es schien nur deshalb eine Zeitlang den Markt zu beflügeln, weil man die Häuslebauer im Unklaren über ihre Zinsbelastung gelassen und die Anleger hinsichtlich der zu erzielenden Rendite systematisch getäuscht hat. Spiele am Devisenmarkt wie in Island, Ungarn oder Rumänien sind in aller Regel unmittelbar und in massiver Weise schädlich für die reale Wirtschaft, weil sie die Wechselkurse ebenso systematisch in die falsche Richtung treiben.
Kredit für die wirklich investierenden Unternehmen können auch Banken schaffen, die sich solcher Kasinoaktivitäten vollständig enthalten. Man sollte nicht vergessen, dass es zu Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders noch selbstverständlich war, das Zinsgebahren der Banken streng zu kontrollieren. Auch ein Land wie China hat sein noch größeres Wirtschaftswunder bei strenger Kontrolle des Staates über Soll- und Habenzinsen geschafft. Begreifen kompetente Wirtschafts- und Finanzpolitiker nun solche Zusammenhänge wieder, ist es ein Leichtes, die eklatanten regulatorischen Lücken zu schließen.
Auch die Lücken in der internationalen Finanzaufsicht sind offensichtlich. Die besten Vorschriften über die Hinterlegung von Bankaktivitäten mit Eigenkapital, wie sie beispielsweise bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich formuliert werden, nutzen nichts, wenn die Einschätzung von Risiken allein einer kleinen Gruppe von Ratingagenturen überlassen wird, die wiederum aufgrund von Unfähigkeit oder Unwissen die wildesten Derivatkonstruktionen mit hohen Qualitätsmerkmalen versehen. Auch hier müssen die staatlichen Organe selbst Hand anlegen und dafür sorgen, dass solche Ratings von nicht interessengebundenen Institutionen wie einer Finanzaufsicht kritisch überprüft und nötigenfalls korrigiert werden. Jedes medizinische oder chemische Produkt wird von staatlichen Aufsichtsbehörden genehmigt, nur die gängigen .finanziellen Massenvernichtungswaffen. (Warren Buffet) darf derzeit jeder vertreiben, ohne dass der Staat einschreitet.
Es ist ein Skandal, dass die Bankenaufsicht in vielen Ländern einschließlich Deutschlands geduldet hat, dass die Banken hochriskante Geschäfte außerhalb der Bilanzen laufen lassen. Dabei war doch klar, dass die Bank am Ende für Verluste bei diesen Geschäften haftbar gemacht würde.
Da aber die beteiligten Ratingagenturen sich ohnehin auf den rechtlichen Standpunkt zurückziehen, ihre Risiko-Einschätzungen seien eben nur eine Meinung, und sonst nichts, kann man eigentlich getrost auf sie verzichten. Besser überließe man es den Banken selbst, die Einschätzung der Risiken von allen in ihrem Besitz befindlichen Papieren vorzunehmen. Das würde immerhin dazu führen, dass auch Bankvorstände endlich (besser) verstehen, wovon sie reden.
Schließt das Wechselkurs-Spielkasino
Schließlich muss das größte Kasino . dasjenige nämlich, in dem internationale Währungen gehandelt werden . schlicht geschlossen werden. Es geht weniger denn je an, dass der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft, der Wechselkurs, den kurzfristigen Gewinninteressen internationaler Spekulanten und Finanzhaie überlassen wird.
Insgesamt gesehen ist es eigentlich ganz einfach: Finanzmärkte braucht man, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass sie massiv reguliert werden müssen. Denn sie erzeugen gefährliche Spielzeuge, indem Leute in ihrer Gier nach kurzfristigem Gewinn auf unverantwortliche Weise mit dem Geld anderer Leute spekulieren in der Hoffnung, dass es genügend Dumme auf der Welt gibt, die nicht merken, wie sie von smarten Bankern über den Tisch gezogen werden.
In Zukunft muss jedes Prahlen mit extremen Renditen von der Finanzaufsicht, den Finanzministerien und den Zentralbanken sofort zum Anlass genommen werden zu prüfen, zu wessen Lasten die übermäßigen Gewinne des betreffenden Finanzinstituts gehen. Auch für die Gehälter von Vorständen und Aufsichtsräten müssen staatlicherseits Grenzen gesetzt werden, weil es ja offensichtlich ist, dass diese Vorstände und Aufsichtsräte systematisch eine Beteiligung des Staates an den Verlusten erwarten. Wäre das nicht so, würden sie viel gründlicher prüfen, woher ihre Gewinne kommen und mit welchen Risiken sie behaftet sind.
Nichts wird . und darf . mehr so sein wie früher
Noch ist das Ende der Finanzkrise bei weitem nicht absehbar. Wir werden es aber erst dann wirklich erreichen, wenn wir zu begreifen beginnen, dass Finanzmärkte ganz anders funktionieren als Gütermärkte. Dann begreifen wir nämlich auch sofort, dass Finanzmärkte niemals sich selbst überlassen werden dürfen. Erforderlich ist eine gewaltige Anstrengung, den gesamten Markt neu aufzustellen und die Regulierung ganz neu zu organisieren. Nichts darf mehr so sein wie vorher. Bestimmte Geschäfte mit sehr komplizierten Finanzmarktprodukten müssen einfach verboten oder mit so hohen Hürden versehen werden, dass sie sich nicht mehr lohnen.
Das jetzt konservative Zentralbanker die Verstaatlichung des gesamten Bankensystems diskutieren, zeigt den ganzen Irrsinn des Systems: Erst nehmen die Banken die Bürgerinnen und Bürger aus, indem sie wahnwitzige Renditen erzwingen und sich unglaubliche Gehälter leisten. Und am Ende ist der Staat gezwungen einzugreifen, damit diese Spielsüchtigen nicht das ganze System zugrunde richten.
Die langfristige Folge der Krise liegt bereits heute auf der Hand: der dramatische Einbruch des Wachstums. Es ist kaum vorstellbar, dass die amerikanischen Bürger so weiter konsumieren, wie sie es in den vergangenen zehn Jahren getan haben. Sie werden sich extrem zurückhalten, und auch die Banken werden sich, zu Recht, bei der Vergabe von Krediten stark beschränken.
Auch in Deutschland müssen wir uns deshalb auf eine ganz andere Zeit einstellen. Der Aufschwung war schon vorbei, als es an den Finanzmärkten erstmals so richtig gekracht hat. Schon damals hätten Politik und Europäische Zentralbank (EZB) dagegen halten müssen. Jetzt spricht alles dafür, dass es noch schlimmer kommen wird. Der Dollar wird vermutlich weiter sinken, und die gesamte Weltwirtschaft wird in eine tiefe Rezession abgleiten, wenn sie nicht schon längst darin steckt.
Hier beginnt die besondere Verantwortung Europas. Doch weder die EZB noch die deutschen Finanzpolitiker haben begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Sie haben bis jetzt nicht zur Kenntnis genommen, dass Europa diesmal nicht mehr auf die USA als Lokomotive der Weltwirtschaft setzen kann, sondern selbst die Nachfrage steigern muss. Viel zu lange weigerte sich die EZB, die Zinsen rasch und nachhaltig zu senken, und die Hoffnung vieler Finanzminister, sie könnten mit einem blauen Auge bei der Staatsverschuldung davonkommen, lässt hier das Schlimmste befürchten. Viel zu lange wurde aufgrund einer Inflationsrate von drei Prozent der Zins hochgehalten, obwohl inzwischen jeder weiß, dass die Inflation bei fallenden Rohstoffpreisen im kommenden Jahr wieder zurückgehen wird. Jetzt zeigt sich nämlich auch: Die Preise an den Rohstoffmärkten waren spekulativ überhöht (wie ich bereits vor fünf Monaten sagte, auch dabei einsamer Rufer in der Wüste). Inzwischen ist es aber deutlich sichtbar.
Nach der Krise wird man das Mandat der Europäischen Zentralbank fundamental in Frage stellen müssen. Sie hat versagt, weil sie sich immer darauf zurückziehen kann, ihr einziges Ziel sei die Inflationsbekämpfung. Das führt zu einer dauernden überoptimistischen Einschätzung der wirtschaftlichen Lage, weil jede Gefahr eines Abschwungs in den Augen der Zentralbanker die .Gefahr. eines Drucks auf die Bank auslöst. Das ist, wie ich schon 1998 in der Krise des damaligen Bundesfinanzministers mit der Bundesbank gesagt habe, zwar das Verhalten von kleinen Kindern, die umso uneinsichtiger werden, je mehr man Druck auf sie ausübt, aber wenn Notenbanker sich wie Kinder verhalten, muss man sie auch wie Kinder behandeln. Das heißt, dass man ihnen das gefährliche Spielzeug einfach wegnimmt.
Doch nur wenn durch energische Expansionsmaßnahmen verhindert wird, dass die reale Wirtschaft in ein tiefes Loch fällt, kann man hoffen, dass die für die Stabilisierung der Banken aufgebrachten Milliarden nicht alle verloren sind. Nur bei einer Erholung der Realwirtschaft werden die jetzt wertlosen Papiere in den Tresoren der Banken wieder an Wert gewinnen.
Dann werden die staatlichen Bürgschaften nicht gebraucht, und der Staat wird . sollten seine Vertreter in der Bundesregierung zumindest in diesem Punkt Mindeststandards eingehalten haben . an dem Gewinn beteiligt sein. Wenn jedoch am Ende dieser Krise all jene Bürgerinnen und Bürger die Zeche zahlen müssen, die an der grassierenden Maßlosigkeit der Banken völlig unbeteiligt waren, wird die Demokratie in Deutschland gewaltigen Schaden nehmen.
1 Vgl. Heiner Flassbeck, Glasperlenspiel oder Ökonomie. Der Niedergang der Wirtschaftswissenschaften, in: .Blätter., 9/2004, S. 1071-1079.






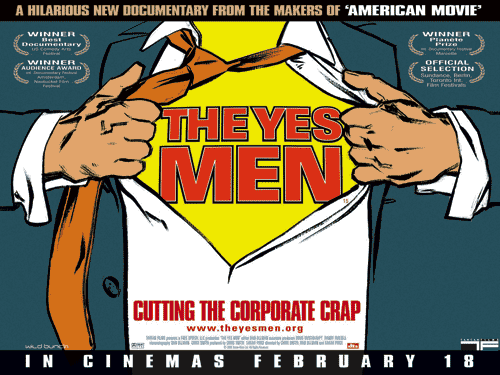





 Erdmagnetfeld:
Erdmagnetfeld:
